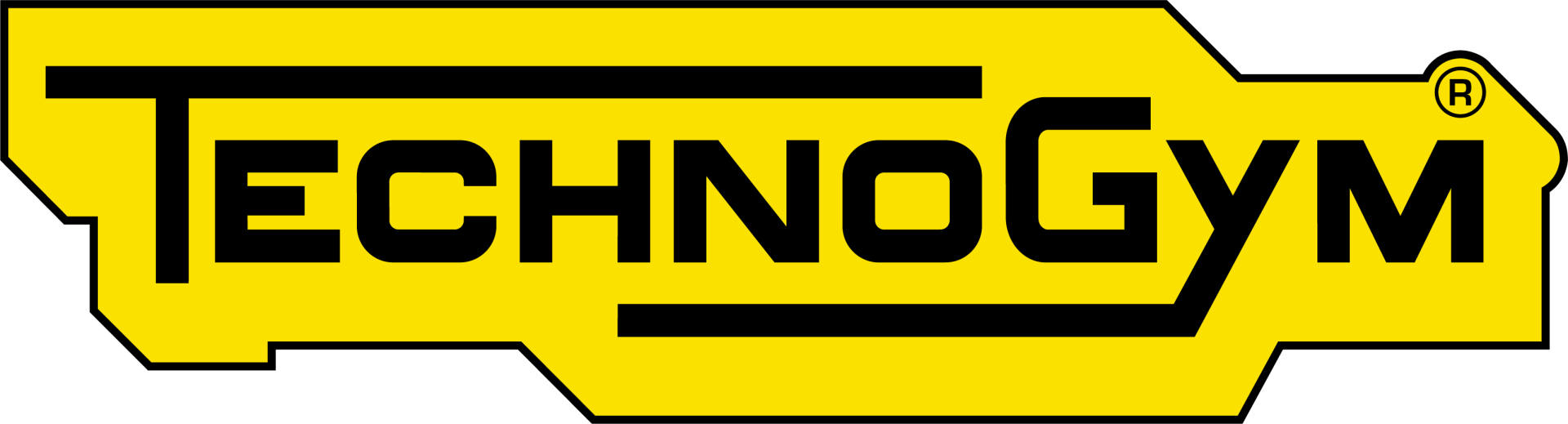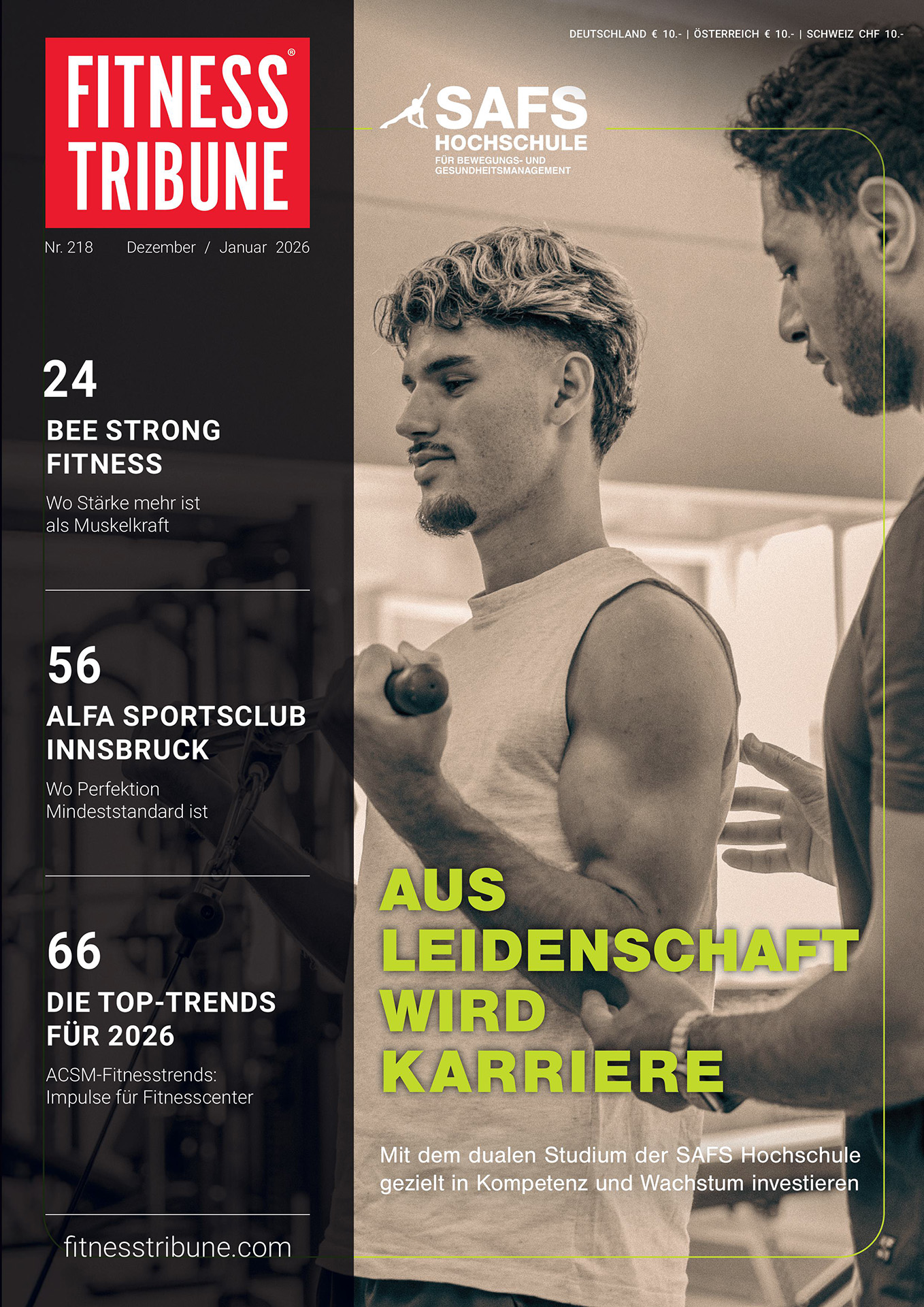Während der Schwangerschaft wird häufig die Mitgliedschaft im Fitnesscenter gekündigt oder der Vertrag „auf Eis gelegt“. Oftmals führt die Befürchtung, Fitnesstraining könnte dem ungeborenen Kind schaden oder die Schwangerschaft negativ beeinflussen, zu dieser Entscheidung. Doch diese Zweifel können entkräftet werden.
Ein oft zitierter Satz der deutschen Ausnahmeläuferin Gesa Krause (32), die sich während ihrer Schwangerschaft immer wieder der Kritik stellen musste, ob sie mit falschem Ehrgeiz und übertriebenem Trainingspensum bis kurz vor dem Entbindungstermin der Gesundheit ihres ungeborenen Kindes schaden würde, war: „Ich bin schwanger und nicht krank.“ Krause absolvierte im neunten Schwangerschaftsmonat noch neun bis zehn Einheiten pro Woche, darunter zwei Laufeinheiten, Aquajogging, Einheiten auf dem Crosstrainer und Pilates.
Historische Betrachtung von Sport in der Schwangerschaft
Die Frage nach Qualität und Quantität von sportlicher Aktivität in der Schwangerschaft beschäftigt nicht nur aktuelle Leistungssportlerinnen. Während aus der Antike berichtet wird, dass Frauen, die körperlich härter arbeiten mussten, leichtere Geburten und fittere Nachkommen hervorbrachten (Diddle, 1984), ist die Sorge, dass grosse Anstrengungen während der Schwangerschaft negative Folgen für Mutter und Kind haben könnten, eine relativ „junge“ Ansicht. Erst um 1900 wurde vor zu grosser Belastung in der Schwangerschaft gewarnt (Palmer, Oakes, Champion, Fischer & Hobel, 1984).
In den 1960er- und 1970er-Jahren änderte sich die Einstellung gegenüber Sport in der Schwangerschaft wieder, da sportliche Frauen von deutlich leichteren Geburten sprachen. Die positiven Auswirkungen leichter bis moderat-intensiver sportlicher Aktivität in der Schwangerschaft sind mittlerweile unumstritten und werden für die Mutter und das ungeborene Kind in nahezu jedem Schwangerschaftsratgeber hervorgehoben.
Dem schwangerschaftsbetreuenden Personal steht im deutschsprachigen Raum, anders als in vielen anderen Ländern, allerdings keine offizielle Empfehlung oder Leitlinie als Unterstützung zur Schwangerenberatung zur Verfügung, sodass Unsicherheiten bezüglich dieser Empfehlungen vorliegen (Herzberger, Bäz, Kunze, Markfeld-Erol & Juhasz-Böss, 2022). Laut dem American College of Obstetricians and Gynecologists (ACOG) können Freizeit- und Wettkampfsportlerinnen ihren Sport auch während der Schwangerschaft weiter ausüben, sofern aus medizinischer Sicht keine Kontraindikationen bestehen (Artal & O’Toole, 2003).
Welchen Einfluss hat Sport auf die Schwangerschaft?
Ob eine schwangere Person sportlich aktiv bleibt bzw. wird oder ob sie eine sportlich inaktive Schwangerschaft durchlebt, ist häufig von der Einstellung des Arztes oder der Ärztin zu dieser Thematik abhängig. Ist das ärztliche Personal selbst sportlich inaktiv oder fehlt es an Wissen über geeignete Sportarten, werden Schwangere eventuell zu wenig über die positive Wirkung von Sport aufgeklärt. Jedoch befürworten immer mehr Ärztinnen und Ärzte Sport in der Schwangerschaft und unterstützen die Frauen in ihrem Streben nach einem gesunden Lebensstil (Oberhofer, 2019).
Eine systematische Literaturrecherche von Herzberger et al. (2022) kommt zu der Schlussfolgerung, dass regelmässige körperliche Aktivität in der Schwangerschaft zu einer Reduktion der gestationsbedingten Gewichtszunahme führt und das Risiko für eine übermässige Gewichtszunahme sowie Schwangerschaftsdiabetes (GDM) senkt, ohne dabei das Risiko für eine Frühgeburt zu erhöhen. Bereits 140 Minuten moderate Bewegung pro Woche können das GDM-Risiko um 25 Prozent reduzieren; 180 Minuten pro Woche senken es sogar um 35 Prozent. Des Weiteren hat körperliche Aktivität das kindliche Geburtsgewicht in keiner Studie negativ beeinflusst. Darüber hinaus gab es in keiner Studie Hinweise darauf, dass Sport zu einer erhöhten Frühgeburtsrate führt (Herzberger et al., 2022).
Darf man weiterhin im Fitnesscenter trainieren?
Viele schwangere Trainierende kündigen ihre Mitgliedschaft im Fitnessstudio oder lassen diese ruhen, weil sie unsicher sind, ob ein Training im Fitnesscenter noch „erlaubt“ bzw. welches Belastungsgefüge für ihr Training geeignet ist. Bestehen allerdings weder absolute noch relative Kontraindikationen (Wieloch, Kimmich, Spörri, Matter & Scherr, 2020; Ferrari & Joisten, 2021), gibt es keine Argumente, die gegen ein Training im Fitnessstudio sprechen. Für Schwangere bietet es sogar Vorteile, etwa mithilfe einer professionellen Betreuung mit individuell abgestimmten Trainingsplänen. Für Fitnesscenterbetreiber bedeutet die Betreuung von Schwangeren auch eine Chance zur dauerhaften Kundenbindung. In dieser Lebensphase ist diese Zielgruppe sehr empfänglich für die Implementierung von körperlicher Aktivität in ihren Alltag (Herzberger et al., 2022).
Darf man weiterhin Krafttraining betreiben?
Auch in der Schwangerschaft hat Krafttraining zahlreiche positive Effekte (Cilar Budler & Budler, 2022) und kann zur Linderung schwangerschaftstypischer Beschwerden beitragen. Neben den allgemeingültigen Grundsätzen, die für jedes Krafttraining zu beachten sind, sollte während der Schwangerschaft besonders auf die korrekte Atmung geachtet und eine Pressatmung vermieden werden. Es sollte von Kraftleistungen mit Lastvorgabe – maximal sowie submaximal – Abstand genommen und nach dem individuellen Belastungsempfinden trainiert werden: Die Intensität sollte subjektiv als moderat bis etwas anstrengend eingestuft werden (Artal & O’Toole, 2003). Das Training findet als Ganzkörpertraining statt. Fühlt die Schwangere sich wohl, sollten pro Woche zwei Krafttrainingseinheiten absolviert werden.
Welche Übungen sind im Krafttraining zu empfehlen?
Wie bei jeder Trainingsplanung müssen individuelle Faktoren (Kontraindikationen, Erkrankungen, sportliche Vorgeschichte etc.) sowie Vorlieben und Wünsche berücksichtigt werden. Die Übungsauswahl hängt stark von der Grösse des Bauches ab. Mit wachsendem Bauchumfang sollten die Übungen ausgetauscht werden, die nicht mehr absolviert werden können. Da längeres Stehen den venösen Rückstrom verringert, sollten Kräftigungsübungen im Sitzen bevorzugt werden. Besonders im letzten Schwangerschaftsdrittel klagen viele Schwangere zudem über geschwollene Beine sowie Füsse – diese sollten daher möglichst oft entlastet werden. Zudem sind alle Übungen, die zu einem Anstieg des intrathorakalen Drucks führen, zu vermeiden, da auch hierbei der venöse Rückstrom erheblich beeinträchtigt wird.
Während manche die Beinpresse bereits in der Frühschwangerschaft als unangenehm empfinden, trainieren andere noch im letzten Drittel ohne Beschwerden an diesem Gerät. Die Beinpresse kann gegen die isolierten Übungen Beinstrecker und Beinbeuger sitzend getauscht werden, da bei diesen Übungen keine Flexion im Hüftgelenk erfolgt. Diese Übungen kräftigen die Oberschenkelmuskulatur, die somit das ansteigende Körpergewicht im Alltag leichter tragen kann. Wadenheben im Sitzen kräftigt neben der Wadenmuskulatur auch die Bandstrukturen der Sprunggelenke.
So kann der Gefahr des Umknickens aufgrund der hormonell aufgelockerten Bandstrukturen präventiv begegnet werden. Hüftstrecken am Hüftpendel kräftigt neben der Gesässmuskulatur und der Oberschenkelrückseite auch die Rumpfstabilisatoren. Beim Bauchmuskeltraining sollte die schräge Muskulatur so lange wie möglich dynamisch trainiert werden und die gerade Muskulatur eher statisch. Die Übungen an der Rückenstreckmaschine im Sitzen sowie Latziehen und Rudern horizontal stärken den unteren Rücken. Die Übungen Butterfly und Brustpresse im Sitzen kräftigen hingegen die Brustmuskulatur. Sollte bei der Bewegungsausführung das Brustpolster an Kraftmaschinen zu Schmerzen führen oder als unangenehm empfunden werden, können alternativ Übungen am Kabelzug in Erwägung gezogen werden.
Was sollte vermieden werden?
Grundsätzlich sollte von Sportarten mit sehr starker Anspannung der Bauchmuskulatur und Belastung des Beckenbodens (z. B. Krafttraining mit annähernd maximalen Lasten), mit Stoss- und Schlaggewalt (z. B. Kampfsportarten), mit hohem Sturz- oder Verletzungsrisiko, mit ruckartigen Bewegungen und Erschütterungen Abstand genommen werden. Das gilt auch für sportliche Aktivität mit Sauerstoffmangel sowie in grosser Hitze oder Kälte. Ebenso sind solche Sportarten zu vermeiden, bei denen eine ausreichende Sauerstoffversorgung für das Kind ungewiss ist (Wieloch et al., 2020).
Gesa Krause hat im Übrigen im April 2024, ein Jahr nach der natürlichen Geburt ihrer gesunden Tochter, in ihrem ersten Wettkampf über 3000-Meter-Hindernislauf die Olympia- und EM-Norm geschafft.
Fazit
Letztlich ist jede Schwangerschaft individuell. Daher können keine pauschalen Vorgaben für die Gestaltung des Krafttrainings gegeben werden. Manche fühlen sich durchgehend elend und können das Ende der Schwangerschaft kaum erwarten, andere sind dagegen kaum eingeschränkt und gehen auch mit wachsendem Babybauch normal ihrem Alltag nach. Auf übergeordneter Ebene gibt es umfangreiche empirische Belege dafür, dass ein individuell angepasstes Krafttraining viele positive Einflüsse für Mutter und Kind hat. Ein Garant hierfür ist die Betreuung durch einen fachlich und sozial kompetenten Trainer.
Auszug aus der Literaturliste
Cilar Budler, L., & Budler, M. (2022). Physical activity during pregnancy: a systematic review for the assessment of current evidence with future recommendations. BMC Sports Science, Medicine and Rehabilitation, 14(1), 133.
Herzberger, V., Bäz, E., Kunze, M., Markfeld-Erol, F. & Juhasz-Böss, I. (2022). Körperliche Aktivität in der Schwangerschaft. Deutsches Ärzteblatt International, 119; 793–7.
Wieloch, N., Kimmich, N., Spörri, J., Matter, S. & Scherr, J. (2020). Leistungssport und Schwangerschaft – aktuelle Empfehlungen und Güte der aktuellen Evidenzlage. SEMS-journal (Sports & Exercise Medicine Switzerland), 68 (4), 10–16.
Für eine vollständige Literaturliste kontaktieren Sie bitte info@fitness-tribune.com.