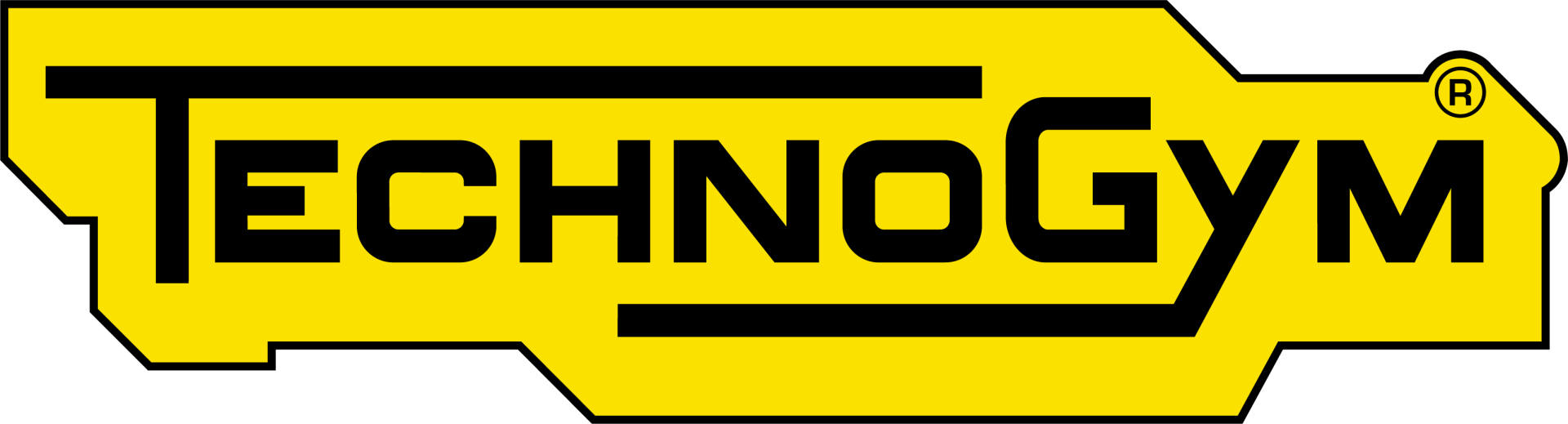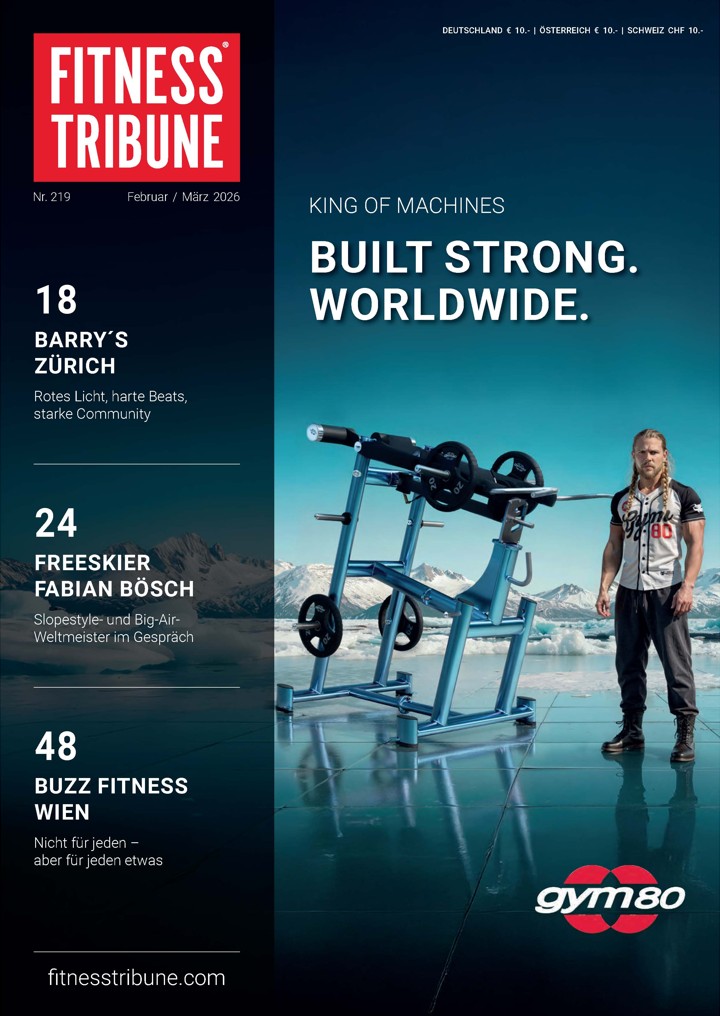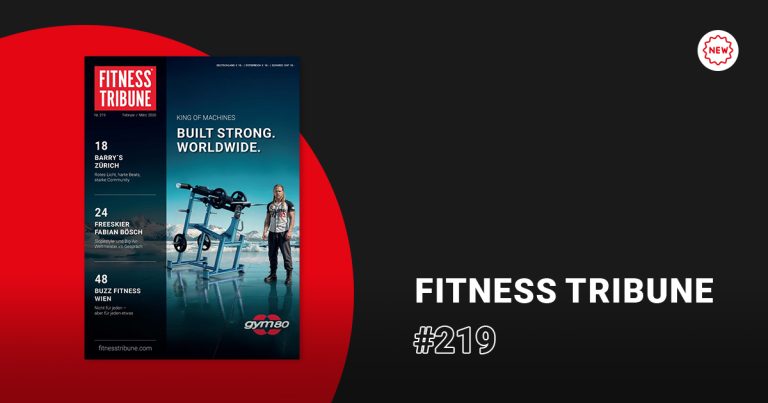Unsere Haut gilt mit 1,5 bis zwei Quadratmetern nicht nur als unser grösstes Organ – sie ist auch ein wahres Multitalent. Sie besitzt unbekannte Fähigkeiten: schützt, reguliert, warnt und spiegelt unsere Gesundheit. Gleichzeitig ist sie täglich Belastungen ausgesetzt. Doch was leistet die Haut tatsächlich? Wir klären auf.
Die Bedeutung unserer Haut geht weit über Ästhetik hinaus – auch wenn Schönheitsideale in vielen Kulturen eng mit dem Hautbild verknüpft sind. In manchen Regionen, etwa in Japan und China, gilt ein heller Teint als Ausdruck von Eleganz und Gepflegtheit. Andere Gesellschaften, etwa in Europa und Nordamerika, wiederum verbinden einen leicht gebräunten Hautton mit Aktivität im Freien, Freizeit und Lebensfreude
Dennoch sind wir uns hier in Mitteleuropa nicht ganz einig, was eigentlich optimal ist. Während eine blasse Haut fahl wirkt und leicht auf eine innere Krankheit schliessen lässt, kann auch ein dunkler Teint – bei aller Ästhetik – gesundheitliche Warnungen hervorrufen. Denn die „sonnengetränkte“ Bräune, die uns vital erscheinen lässt, ist letztlich eine Schutzreaktion der Haut: ein Hinweis darauf, dass sie sich gegen schädliche UV-Strahlung zur Wehr setzen musste.
Das macht deutlich: Unabhängig von Mode und Idealbildern bleibt die Funktion der Haut dieselbe: Sie ist nicht nur unsere äussere Hülle, sondern ein aktives Organ mit unzähligen, oft unbemerkten Aufgaben – lebenswichtig für Schutz und Gesundheit.
Wir finden in unserer Haut auf jedem Quadratzentimeter (health&media GmbH, o. J.):
- 600 000 Zellen
- 5000 Sinneskörper
- 900 – 1000 Pigmentzellen
- 400 cm Nervenfasern
- 200 Schmerzpunkte 100 Schweissdrüsen
- 15 Talgdrüsen
- Fünf Haare
- 13 Wärmepunkte und zwei Kältepunkte
Unsere Haut hat bemerkenswerte Fähigkeiten
Wichtige Aufgaben, die die Haut u. a. übernimmt: Sie aktiviert das Immunsystem und wehrt sich mit der Produktion von Melanin und der Verdickung der oberen Hautschicht (der sogenannten Lichtschwiele). Ausserdem schützt sie uns mit der Bildung eines Säureschutzmantels, auch Hydrolipidfilm genannt, und bildet damit eine Barriere gegen Umwelteinflüsse (u. a. Feinstaub, Chemikalien).
Sie unterstützt ausserdem die Produktion des für uns so wichtigen Vitamin D und wird dadurch zu einer weiteren Barriere gegen ganz verschiedene Gefahren aus unserer Umgebung, z. B. gegen Erkältungen oder Atemwegsinfekte. Der Hintergrund: In der Haut befinden sich genügend Rezeptoren für die Vitamin-D-Synthese, die Schätzungen zufolge bis zu 80 Prozent des Bedarfs über die Haut abdecken kann. Wichtig: Es braucht eben das Sonnenlicht dazu – denn insbesondere UV-B-Strahlen stossen Prozesse in der Haut an (Holick, 2007).
Die Haut schützt uns des Weiteren vor Keimen, Kälte sowie UV-Strahlen – und sogar Ozon wird abgeblockt und absorbiert. Diese Fähigkeit wurde durch eine bemerkenswerte Entdeckung von Forschern an der Uniklinik Innsbruck bekannt: Sie fanden heraus, dass die Haut in der Lage ist, aus der Luft Ozon zu saugen. Ein einziger Mensch kann somit vorhandenes Ozon in einem kleinen Raum um bis zu zwei Prozent vermindern, so das Ergebnis dieser Studie (Wisthaler & Weschler, 2010). Wir sind also selbst eine Art Problemlöser für die Umwelt. Zudem hilft die Haut, unsere Körpertemperatur im Gleichgewicht zu halten – etwa durch Schwitzen, das über ihre Schweissdrüsen gesteuert wird.
„Bodyguard“ schützt vor zu viel Sonnenlicht – aber nicht ungebremst
Neu: Kleingedruckt werden wir im Beipackzettel überraschenderweise von Vitamin-D-Produkten darauf hingewiesen: „Es geht auch mit Sonnenexposition!“ Ist das eine Trendwende in der Beurteilung von Nutzen und Schaden einer Besonnung?
Unsere Haut verfügt über eine natürliche Barriere, die Säureschutzmantel genannt wird. Diese Schranke hält schädliche Mikroorganismen fern, wehrt Bakterien und Viren ab und hilft der Haut, ihren Feuchtigkeitshaushalt in Balance zu halten. Das macht den sogenannten Hydrolipidfilm quasi zum „Bodyguard“ unserer Haut. Nur: Dieser Schutz ist mit der Zeit immer mehr in Gefahr.
Einige Stoffe gelten bei empfindlicher Haut als problematisch für unseren Schutzmantel:
- Künstliche Emulgatoren und Tenside, die wichtige Fette der Haut lösen können. Dadurch verliert die Haut ihre Spannkraft und trocknet aus.
- Konservierungsstoffe, die für die Haltbarkeit von Pflegeprodukten eingesetzt werden.
- Duftstoffe, Ceramide, Glycerin und Alkohol. Diese finden wir in zahlreichen Kosmetikprodukten.
Wir sehen auch eine Industrie mit hohem Umsatzvolumen – z. B. die Kosmetikindustrie mit rund 358 Milliarden US-Dollar Umsatz in 2024 (Business Research Insights, 2024a). Bei den Verkäufen von Sonnenschutzcremes erreichte sie einen globalen Umsatz von 12,6 Milliarden US-Dollar im Jahr 2024 (Business Research Insights, 2024b).
Gibt es denn keine anderen Ideen für straffere Haut?
Zentral für ein frisches Hautbild ist der Wassergehalt in der Haut (health&media GmbH, O. J.). Ist dieser ausreichend, wirkt sich das positiv auf die Hautstruktur aus – sie erscheint gesünder. Und auch wenn über das Schwitzen Wasser verloren geht, transportiert dieser bekannte Vorgang Wasser an die Hautoberfläche. So helfen Sport, körperliche Arbeit und auch die Saunagänge dabei, die Hautfunktion zu unterstützen. Die Haut trocknet dort nicht aus – vorausgesetzt, der Flüssigkeitshaushalt bleibt im Gleichgewicht (Murota et al., 2015).
Eigentlich leicht zu erklären: Um unseren Körper zu kühlen, verschieben wir Flüssigkeit zwecks Verdunstung in unsere „Aussenschale“ – sie verdunstet und sorgt für Abkühlung.
Der zweite Teil der Kolumne erscheint in Ausgabe 216.
Literaturliste
Business Research Insights. (2024a). Cosmetic Market Size, Share & Industry Analysis by Type, Application, Regional Outlook, and Forecast 2024–2031. Verfügbar unter https://www.businessresearchinsights.com/market-reports/cosmetic-market-121107
Business Research Insights. (2024b). Sunscreen Market Size, Share & Industry Analysis By Type, Application, Regional Outlook, and Forecast 2024–2031. Verfügbar unter https://www.businessresearchinsights.com/market-reports/sunscreen-market-118654
health&media GmbH. (o. J.). Aufbau der Haut. Verfügbar unter https://www.haut.de/haut/fakten-zur-haut/aufbau-der-haut/
Holick, M. F. (2007). Vitamin D Deficiency. The New England Journal of Medicine, 357(3), 266–281.
Murota, H., Matsui, S., Ono, E., Kijima, A., Kikuta, J., Ishii, M. et al. (2015). Sweat, the driving force behind normal skin: an emerging perspective on functional biology and regulatory mechanisms. Journal of Dermatological Science, 77(1), 3–10.
Wisthaler, A. & Weschler, C. J. (2010). Reactions of ozone with human skin lipids: sources of carbonyls, dicarbonyls, and hydroxycarbonyls in indoor air. Proceedings of the National Academy of Sciences, 107(15), 6568–6575.