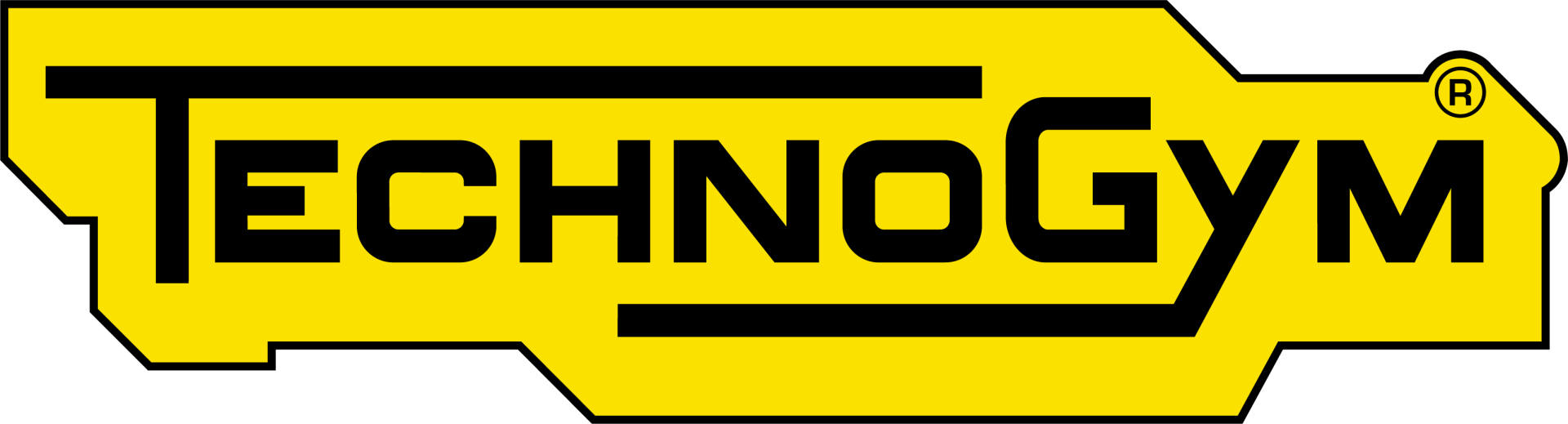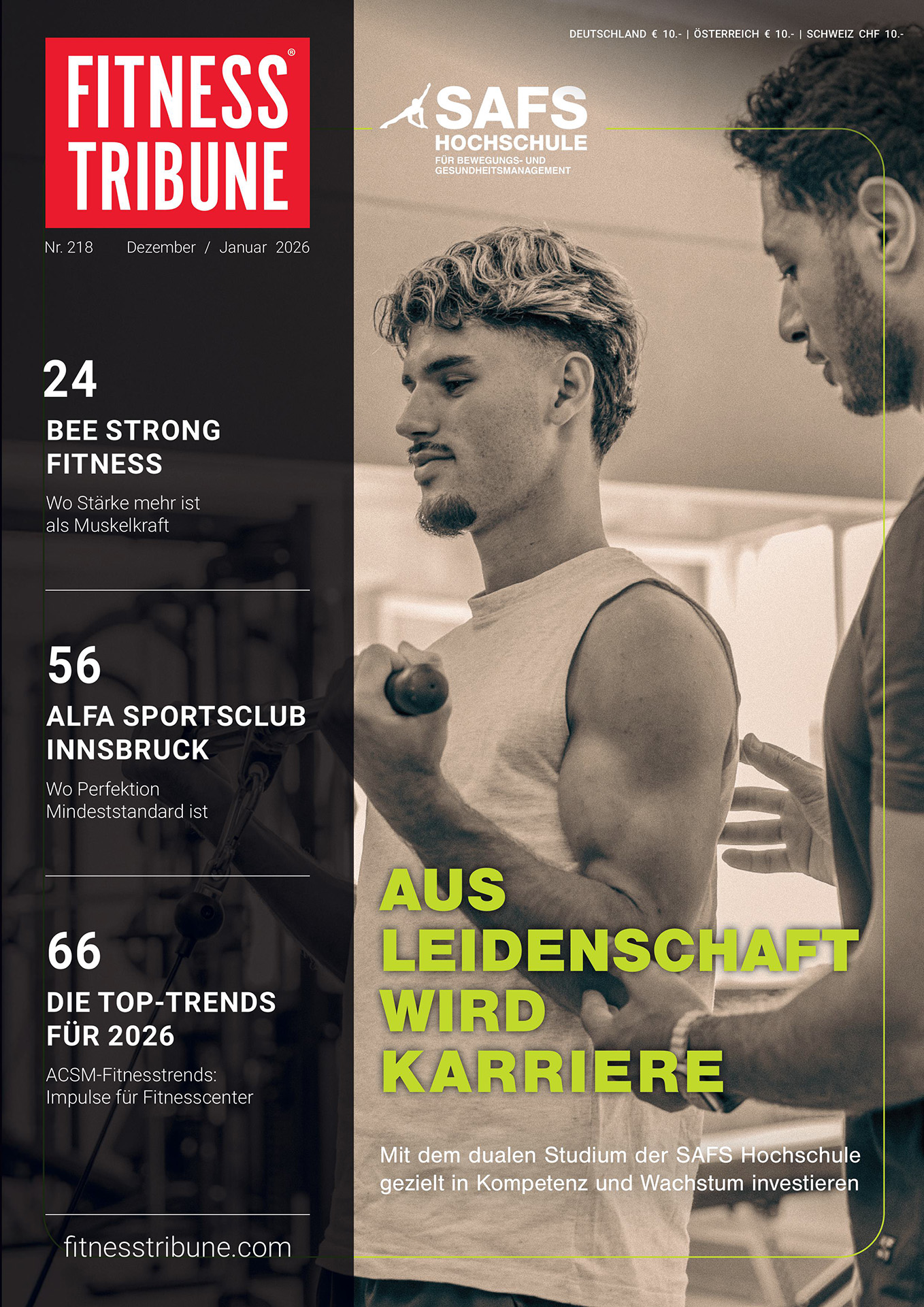Nahrungsfasern haben ein eher verstaubtes Image. Die meisten Menschen haben zwar schon von ihnen gehört, wissen, dass sie gut für den Darm sind und dass sie in den Speiseplan gehören. Doch wofür braucht der Körper sie, wie viel sollte man am Tag davon essen und wo sind sie enthalten?
Nahrungsfasern werden, genauso wie sekundäre Pflanzeninhaltsstoffe, den bioaktiven Substanzen zugeordnet. Das bedeutet, sie sind gesundheitsfördernde Nahrungsinhaltsstoffe, die aber nicht, wie Vitamine und Mineralstoffe, zu den essenziellen Nährstoffen gehören (Leitzmann & Keller, 2020). Sie werden oftmals in zwei Gruppen kategorisiert, in wasserlösliche und wasserunlösliche Nahrungsfasern. Da diese jedoch fast immer zusammen in einem Lebensmittel vorkommen, kann die Einteilung in der Praxis vernachlässigt werden.
Wirkung
Nahrungsfasern sind eine heterogene Gruppe schwer verdaulicher Verbindungen, meist handelt es sich um komplexe Kohlenhydrate. Diese werden im Dünndarm nicht verdaut oder aufgenommen und gelangen in den Dickdarm, wo sie ihre Hauptwirkungen entfalten (Meier, 2018; Schek, 2011). Allerdings sind die Wirkungen und physiologischen Funktionen von Nahrungsfasern sehr umfangreich und bis heute Untersuchungsgegenstand aktueller Forschungen.
Bereits im Mund beeinflussen sie die Zahngesundheit positiv. Die Faserstruktur, insbesondere von Zellulose und Lignin, erhöht den Kauaufwand und dadurch die Speichelproduktion. Die Zähne werden damit vermehrt umspült und die bakteriell gebildeten Säuren können besser neutralisiert werden (Leitzmann & Keller, 2020).
Im Magen wird durch die Quellfähigkeit und die Viskosität einiger Nahrungsfasern die Magenentleerung verzögert, was für eine längere Sättigung sorgt (Vaupel & Ristow, 2018). Ausserdem tragen Nahrungsfasern zu einer normalen Darmtätigkeit bei.
Die wasserunlöslichen Nahrungsfasern quellen auf und vergrössern das Stuhlvolumen. Dadurch wird die sogenannte Darmperistaltik angeregt, sodass die Passagezeit des Darminhaltes abnimmt (Meier, 2018). Zudem wird das Stuhlvolumen über die Zunahme der Bakterienmenge erhöht. Die wasserlöslichen Nahrungsfasern bieten nützlichen Darmbakterien ein gutes Nahrungssubstrat, wodurch sie sich besser vermehren können und sich die Bakterienmasse erhöht.
Diese Art von Nahrungsfasern wird auch als Präbiotika bezeichnet (Schweizerische Gesellschaft für Ernährung [SGE], 2025). Bis zu 50 Prozent der Stuhltrockensubstanz können aus Bakterien bestehen (Stange & Leitzmann, 2018). Durch die bakterielle Fermentation der Nahrungsfasern zu kurzkettigen Fettsäuren kommt es zu einer Senkung des pH-Wertes im Kolon, wodurch das Wachstum pathogener Keime unterdrückt wird (Leitzmann & Keller, 2020).
Die Verkürzung der Transitzeit, d. h. der Zeitdauer zwischen Nahrungsaufnahme und Ausscheidung, des Nahrungsbreis wirkt Fäulnisprozessen und Darmbeschwerden, wie Verstopfung oder einigen Darmerkrankungen, entgegen. Grund hierfür ist, dass die Kontaktzeit unerwünschter Stoffe (z. B. potenziell krebserzeugender Substanzen) mit der Darmschleimhaut verringert ist (Schek, 2011).
Zudem können Nahrungsfasern im Darm Substanzen binden und verringern dadurch ihre Verfügbarkeit. Dieser Effekt ist bei Schwermetallen wie Blei und Cadmium oder bei organischen Schadstoffen praktisch, bei essenziellen Mineralstoffen wie Kalzium, Eisen oder Zink wird die Verfügbarkeit jedoch ebenfalls verringert (Leitzmann & Keller, 2020). Die Vitaminabsorption wird kaum beeinflusst (Elmadfa & Leitzmann, 2023). Ausserdem binden Nahrungsfasern Gallensäuren, sodass mehr Cholesterol ausgeschieden wird (Vaupel & Ristow, 2018).
Tageszufuhr
In den letzten 100 bis 150 Jahren kam es zu deutlichen Veränderungen in den Ernährungsgewohnheiten westlicher Länder. Noch vor ungefähr 140 Jahren lag die Zufuhr an Nahrungsfasern bei bis zu 100 Gramm pro Person am Tag (Stange & Leitzmann, 2018). Bis heute hat sich die Aufnahme von Nahrungsfasern jedoch stark verringert. Im sechsten Schweizerischen Ernährungsbericht wurde der Wert erhoben und zeigt, dass ein Grossteil der schweizerischen Bevölkerung den von der SGE empfohlenen Wert von mindestens 30 Gramm pro Tag nicht erreichte (Bundesamt für Lebensmittelsicherheit und Veterinärwesen [BLV], 2022; Keller et al., 2012).
Personen, die sich vegetarisch oder vegan ernähren, haben oftmals eine höhere Zufuhr an Nahrungsfasern als Mischköstler. Epidemiologische Forschungen zeigen die Tendenz, dass höherer materieller Wohlstand mit einer Abnahme der Nahrungsfaserzufuhr einhergeht (Stange & Leitzmann, 2018). Auch heute sind die Stuhlvolumina zwischen Menschen aus Industrienationen und weniger entwickelten Regionen stark verschieden.
So haben Letztere im Median ein doppelt so hohes Stuhlvolumen wie Proben aus Industrienationen (Daniel, 2024). Die folgende Tabelle zeigt ein mögliches Versorgungsbeispiel, das in der Summe rund 32 Gramm Nahrungsfasern liefert. Andere Komponenten des Speiseplans, die keine Nahrungsfasern liefern, wurden nicht berücksichtigt.
Versorgungsbeispiel für Nahrungsfasern
| Lebensmittel | Menge | Nahrungsfasern (g) |
|---|---|---|
| Haferflocken (kernig) | 5 EL (50g) | 5,0 |
| Heidelbeeren | 125g | 6,1 |
| Apfel | 125g | 2,5 |
| Kidneybohnen (gekocht) | 120g | 6,2 |
| Zucchini | 100g | 1,1 |
| Paprika | 100g | 3,6 |
| Zwiebel | 50g | 0,9 |
| Roggenvollkornbrot | 50g | 4,0 |
| Rote Bete (Konserve) | 60g | 1,4 |
| Baumnüsse | 25g | 1,5 |
Vorkommen
Nahrungsfasern kommen in allen unverarbeiteten pflanzlichen Lebensmitteln vor. Sie sind in strukturgebenden Geweben wie Zellwänden oder den Randschichten enthalten. Besonders Hülsenfrüchte, Nüsse und Vollkorngetreide enthalten viele Nahrungsfasern (Leitzmann & Keller, 2020). Aufgrund der hohen Wasserbindungskapazität von verschiedenen Nahrungsfasern sollte ausreichend getrunken werden, da es sonst zu Verstopfungen kommen kann. Die folgende Tabelle zeigt einige weitere Lebensmittel mit dem entsprechenden Gesamtgehalt an Nahrungsfasern pro 100 Gramm Lebensmittel.
Nahrungsfasergehalt ausgewählter Lebensmittel
| Lebensmittel | Nahrungsfasern (g/100g) |
|---|---|
| Weizenmehl Type 405 | 3,2 |
| Weizenvollkornmehl | 10,0 |
| Haferflocken | 9,5 |
| Haferkleie | 18,6 |
| Blattsalat | 1,6 |
| Karotten | 2,9 |
| Grüne Erbsen (verzehrfertig) | 5,0 |
| Banane | 2,0 |
| Datteln (Trockenobst) | 9,2 |
| Mandeln | 9,8 |
Industriell hochverarbeitete Lebensmittel
Die meisten industriell hochverarbeiteten Lebensmittel haben einen sehr geringen Gehalt an Nahrungsfasern. Zutaten wie Zucker, Weissmehl, Salz und Fett sind quasi frei von Nahrungsfasern und auch eine Ernährung reich an Eiern, Milch und Fleisch trägt nicht zu einer vermehrten Aufnahme bei. Manchmal werden hoch prozessierte Produkte mit Nahrungsfasern angereichert, um damit zu werben.
Oftmals handelt es sich dann um die Zugabe von Weizenkleie, einem günstigen Nebenprodukt aus der Weissmehlherstellung. Durch den enthaltenen hohen Anteil an wasserunlöslichen Nahrungsfasern mit ihrer Wasserbindungskraft und Unverdaulichkeit wird das Stuhlgewicht direkt erhöht. Trotzdem fehlt diesen Produkten die Komplexität natürlicher Lebensmittel mit ihrem Verbund an Begleitstoffen – wie Vitaminen, Mineralstoffen und sekundären Pflanzeninhaltsstoffen. Einige Autoren halten es für möglich, dass ein Isolat wie Kleie anders wirkt als Nahrungsfasern in ihrer natürlichen Lebensmittelmatrix wie Vollkorngetreide oder Gemüse.
Ausserdem gilt zu berücksichtigen, dass einige Nahrungsfasern eine resorptionshemmende Wirkung für bestimmte Mineralstoffe aufweisen. Wenn viele natürliche, pflanzliche Lebensmittel aufgenommen werden, erfolgt zeitgleich eine vermehrte Zufuhr von Mineralstoffen. Somit wird die Bindung durch Nahrungsfasern mehr als ausgeglichen. Dieser Ausgleich wird durch isolierte Nahrungsfaserzugabe in hoch prozessierten Produkten nicht erreicht (Stange & Leitzmann, 2018).
Fazit
Eine regelmässige Zufuhr von Nahrungsfasern in ausreichender Menge ist wichtig für die Aufrechterhaltung der Darmgesundheit und weiterer Funktionen im menschlichen Körper. Natürliche Lebensmittel sollten u. a. aufgrund der weiteren gesundheitsförderlichen Begleitstoffe vor isolierten Ballaststoffpräparaten bevorzugt werden. Da Nahrungsfasern ein Vielfaches ihres Eigengewichts an Wasser binden, muss ausreichend viel getrunken werden.
Auszug aus der Literaturliste
Daniel, H. (2024). Ernährung und Darmmikrobiom: Was sagen uns prähistorische Stuhlproben? Ernährungs Umschau (1), M22-M26.
Schweizerische Gesellschaft für Ernährung. (2025). Nahrungsfasern. Verfügbar unter https://www.sge-ssn.ch/ich-und-du/rund-um-lebensmittel/inhaltsstoffe/nahrungsfasern/
Stange, R. & Leitzmann, C. (Hrsg.). (2018). Ernährung und Fasten als Therapie (2., vollständig aktualisierte Auflage). Berlin: Springer.
Für eine vollständige Literaturliste kontaktieren Sie bitte info@fitness-tribune.com.