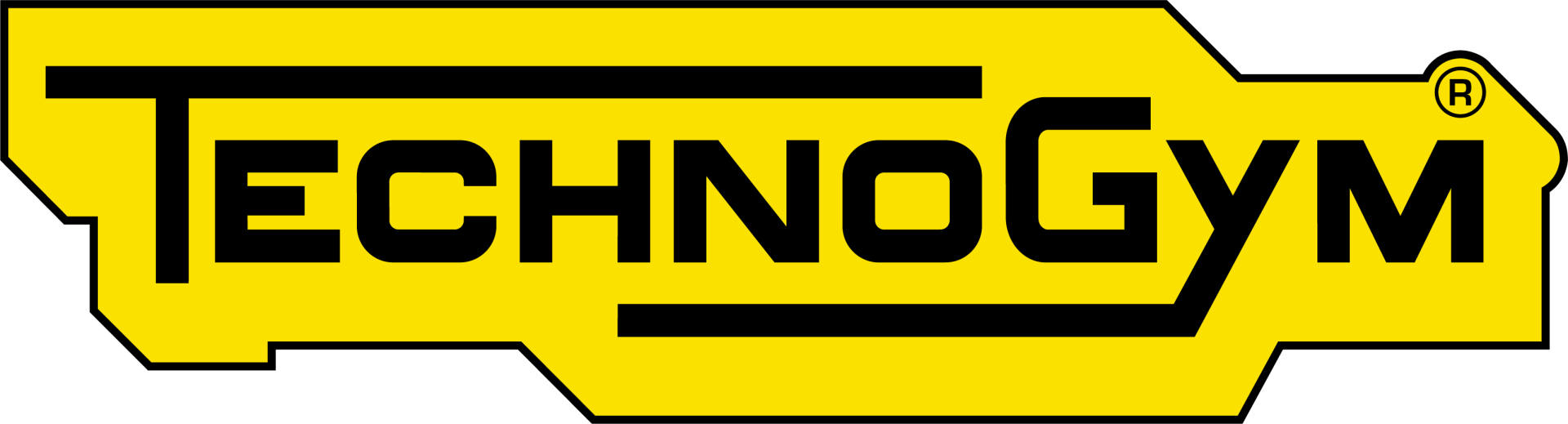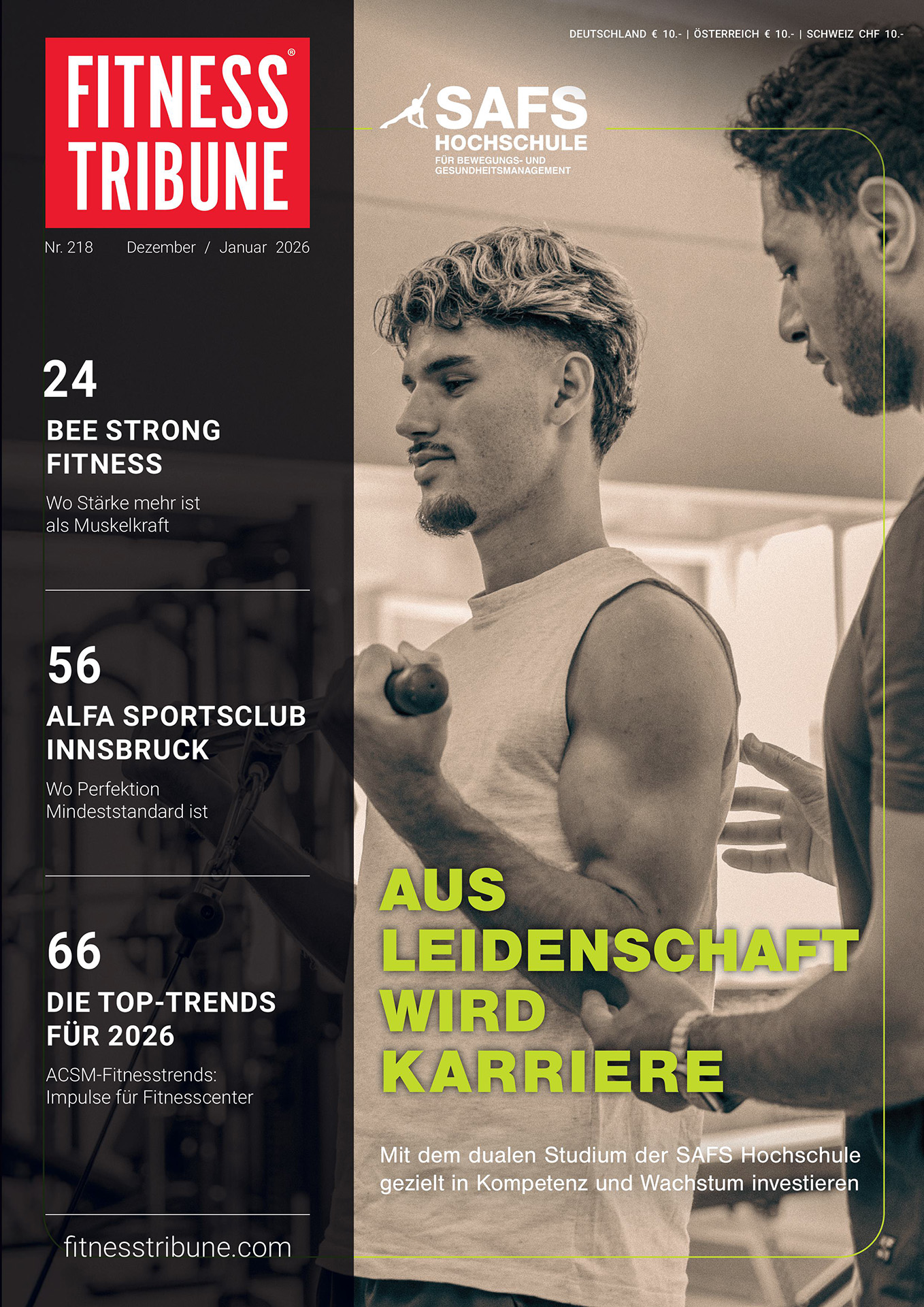Infrarotstrahlung ist ein echter «Allrounder» und heute in vielen Bereichen des Alltags von grosser Bedeutung. Gerade jetzt in der kalten Jahreszeit können Infrarotwärmekabinen Abhilfe schaffen. Was diese «Schwitzbadvariante» so besonders macht – und wo Chancen sowie Risiken liegen.
Der deutsche Astronom Friedrich Wilhelm Herschel entdeckte 1800 erstmals die Infrarotstrahlung jenseits des sichtbaren Spektrums des Sonnenlichts. Wie die Erde auf die Sonnenstrahlung reagiert, so nehmen auch wir Menschen die infraroten Strahlungsanteile auf: Im menschlichen Körper regt diese Energie die chemischen Bindungen in den Molekülen an, sodass sie in unterschiedlicher Weise gegeneinander zu schwingen beginnen und somit Wärme freisetzen.
1967 entwickelte der japanische Arzt Dr. Tadashi Ishikawa die erste Infrarotwärmekabine, die zunächst nur für den medizinischen Gebrauch bestimmt war.
Ein Möbelhersteller aus den Niederlanden machte während einer Geschäftsreise Bekanntschaft mit dem Produkt und wurde zum Erstimporteur. Nach Abklärungen über die möglichen medizinischen Wirkungen dieser Wärmeanwendungen nahmen Importe von Wärmestrahlungskabinen in Europa ihren Anfang. Eine Erfolgsstory hatte begonnen.
Infrarotstrahlung begegnet uns in unserem Alltag ständig: Die Kochplatte in der modernen Küche heizt mit dieser Energie, Farben und Lacke werden in der Industrie damit getrocknet, sie wird auch in der Infrarotfotografie und Hochfrequenzwärme verwendet, die bei modernen Backverfahren zum Einsatz kommt. Beim Physiotherapeuten wärmen uns Deckenstrahler vor einer Behandlung, und auch in Schwitzbädern – wie in der Sauna, in den Thermen und eben in den speziellen Infrarotwärmekabinen – wirkt Infrarotstrahlung.
Das besondere Merkmal der Infrarotstrahlung, einem wichtigen Anteil des Sonnenlichts, ist ihre Wirksamkeit bei der Wärmeentwicklung. Die Sinneszellen unserer Haut nehmen sie als Wärmestrahlung wahr und reagieren darauf. Die entstandene Wärmeenergie wird an den Körper weitergeleitet und wir kommen ins Schwitzen (Schwitzen mit Infrarot (Teil 1)).
Wärmestrahlung ist neben Wärmeleitung und Konvektion eine von drei Möglichkeiten der Wärmeübertragung und resultiert aus der physikalischen Tatsache, dass in der Natur generell ein Bestreben nach Temperaturausgleich besteht. Befinden sich zwei ungleich temperierte Körper sehr nah nebeneinander, so erfolgt der Energiefluss durch Wärmeleitung. Wird die Energie durch die Luft transportiert, so sprechen wir von Konvektion. Wärmestrahlung bedeutet, dass Wärme von einem wärmeren zu einem kälteren Körper als Infrarotstrahlung übertragen wird, ohne die Luft als Medium für die Wärmeübertragung zu benutzen – genau wie es in Infrarotwärmekabinen der Fall ist.
Der grosse Verkaufserfolg dieser «Schwitzbadvariante» ist bei folgenden Punkten zu sehen:
Allgemein muss man die von Fürsprechern angegebene grosse Behaglichkeit in diesen Kabinen und speziell die besondere Wirkungsweise der Wärmestrahlung nennen. Hier erfolgt, wie beim vorher erwähnten Beispiel mit der Sonne beschrieben, kein Wärmeeintrag von aussen, sondern eine verhältnismässig grosse eigene Wärmeproduktion in unserem Körper. Vielen ist es in der Sauna zu heiss. In der Infrarotkabine haben wir angenehme und niedrigere Temperaturen. Sie brauchen weniger Platz, sind leicht aufzubauen und zu platzieren, eine normale Steckdose reicht zur Nutzung schon aus.
Keine Sauna!
Infrarotwärmekabinen wurden lange Zeit so angeboten, als wäre hier eine neue Art des Saunabades entstanden, sozusagen ein neues «Saunatrendprodukt». Anbietern, die einen solchen Vergleich nötig haben, sollte man als Konsument kritisch gegenüberstehen.
Beim finnischen Saunabad sind Raumtemperaturen in der Kabine zwischen 70 und 90 °C empfohlen. Die heisse Luft wird inhaliert und wir «überwärmen» unseren Körper und un-sere inneren Organe – der Körper muss sich «wehren» und schwitzt deshalb.
Bei den Infrarotkabinen kommt der Wärmeeintrag von aussen und vor allem über die Hautoberfläche, überträgt sich über die Blutbahn auf den ganzen Körper – also anders, fast umgekehrt.
Wichtig ist auch zu wissen, dass sich der Kabinenraum zunächst nicht erhitzt wie bei der Sauna. Man muss im Wirkungsbereich der einzelnen Strahler sitzen. Später heizt sich die Kabine auf und dann kommt Wärmestrahlung wie in der Sauna von den Wänden und der Decke an unseren Körper. Die hier verwendeten IRA-Strahlen dringen bis tief in die Unterhaut ein und würden eigentlich die meiste therapeutische Wirkung haben. Sie bringen aber auch die grössten Risiken mit sich. Gewebe- und Augenschäden sind vor allem wegen der künstlich hohen Energieeinträge in diesem (kurzwelligen) langwelligen Bereich zu befürchten.
Will man unbedingt eine vergleichende Argumentation zwischen Infrarotwärmekabine und Sauna betreiben, so sind der geringe Platzbedarf, eine kurze Aufheizzeit der Kabine und ein geringer Stromverbrauch als Vorteile für Infrarotwärmekabinen anzuführen. Grundsätzlich und bei genauerer Betrachtung kann man die Angebote aber kaum vergleichen. Die Sauna ist ein Wechselbad und wird demnach anders angewandt. Als Wechselbad hat sie vor allem sehr starke präventive Wirkung, während Infrarotwärme vermehrt therapeutische Wirkung hat.
Der aktuelle Wissensstand über Infrarotwärmekabinen erinnert an die 60er- und 70er-Jahre, als man auch über das Saunabaden noch nicht sehr viel wusste. Man stellte damals fest, dass man sich nach dem Saunaaufenthalt sehr wohlfühlte, ein Frischegefühl vorhanden war und etwas für die Gesundheit getan hatte. Mittlerweile sind zu den Saunawirkungen über 500 wissenschaftliche Arbeiten im Saunaarchiv dokumentiert. Zu den Wirkungen von Infrarotbädern finden wir nur wenige gesicherte Versuchsreihen.
Weiterhin besteht ein grosser Forschungsbedarf, weshalb seriösere und aussagekräftigere Untersuchungen über die genaue Wirkungsweise von Infrarotwärmekabinen wünschenswert wären.