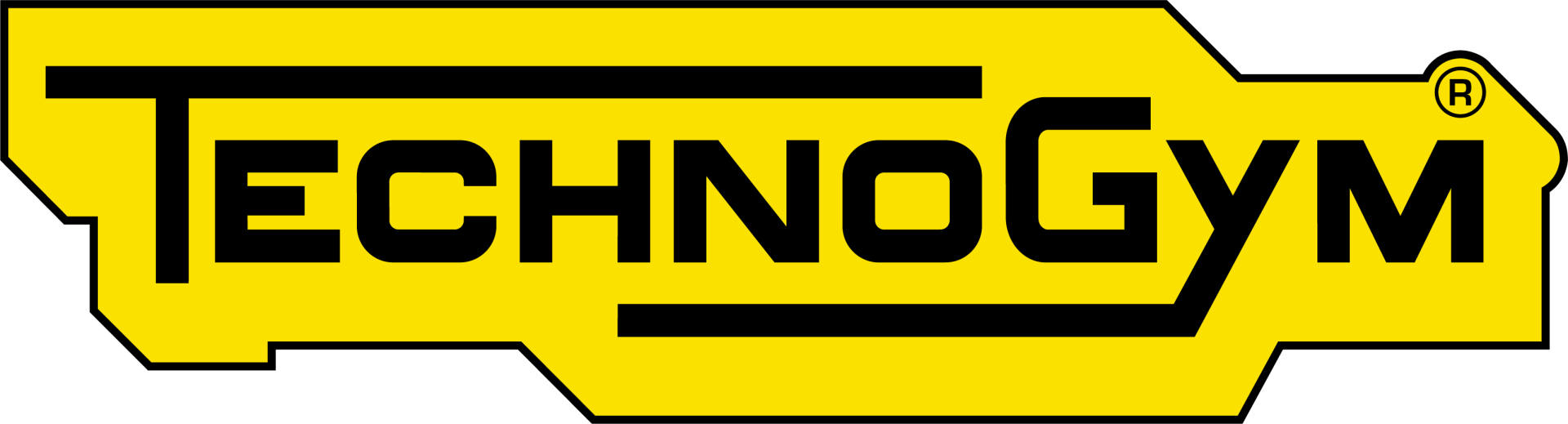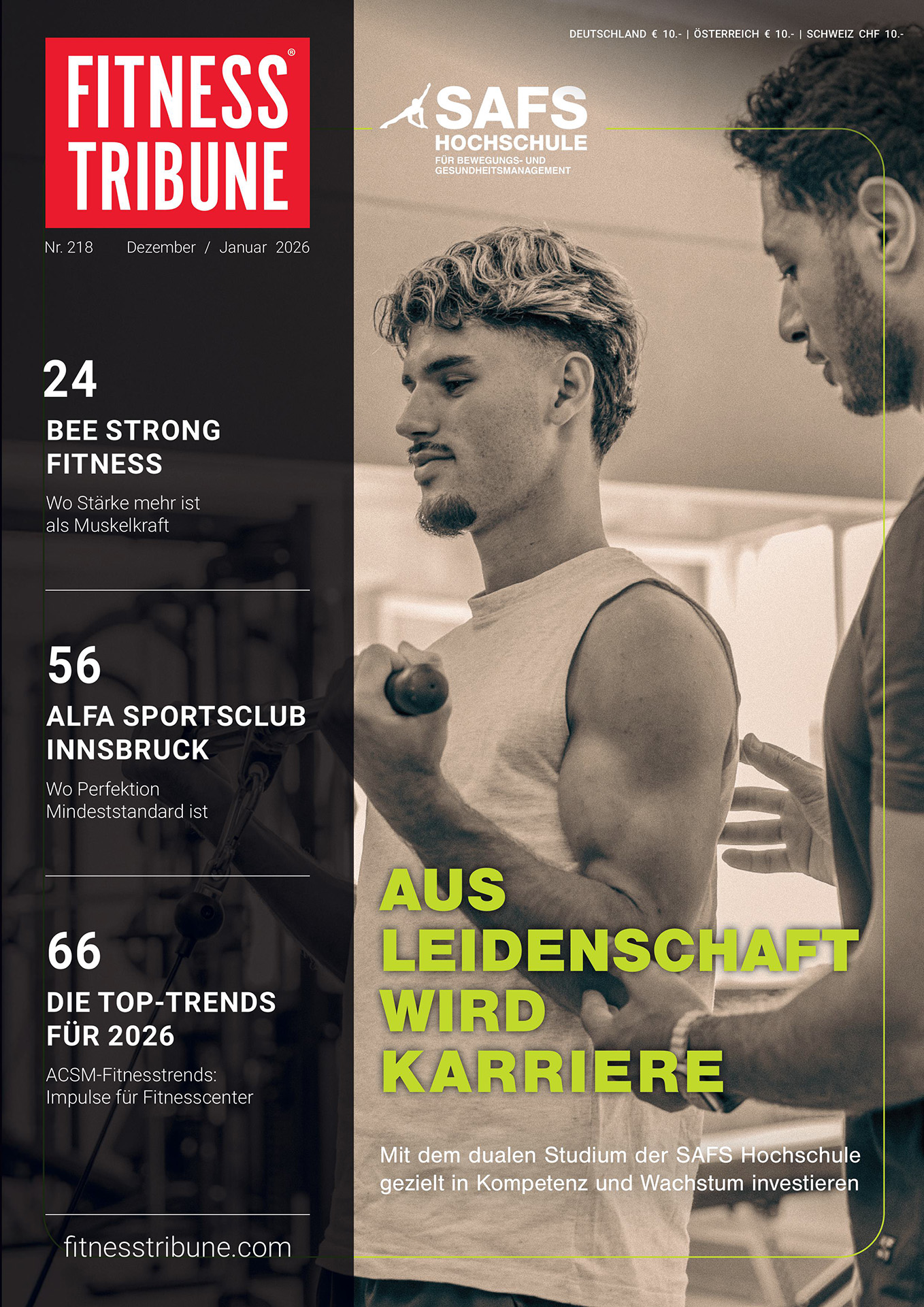Evelyne Binsack ist die erste Schweizerin, die den Mount Everest bestiegen und auf ihren Expeditionen sowohl den Süd- als auch den Nordpol erreicht hat. Die FITNESS TRIBUNE traf die Abenteurerin zu einem exklusiven Gespräch über Freiheit, mentale sowie physische Herausforderungen – und über Lektionen, die sie vom Berg für das Leben gelernt hat.
FITNESS TRIBUNE: Evelyne, du bist eine der ersten diplomierten Bergführerinnen Europas und warst als erste Schweizerin auf dem Mount Everest, am Nord- und am Südpol. Wie fühlt es sich an, so viele Superlative auf sich zu vereinen?
Evelyne Binsack: Naja, das Leben läuft vorwärts – da ist einem das gar nicht so bewusst. Erst im Rückblick wird mir klar, was ich alles geschafft habe. Es ist schön, dass ich auf all diese Erlebnisse zurückschauen kann. Ich muss mir heute nicht mehr die Frage stellen, ob ich noch mehr erreichen könnte und ob ich wirklich alles gegeben habe. Ich stand wortwörtlich an der Grenze. Ein Schritt weiter, und ich wäre nicht mehr zurückgekommen. Und das gibt mir tatsächlich mittlerweile auch eine gewisse Ruhe. Ein Bekannter fragte mich einmal: „Evelyne, was machst du als nächstes?“ – und ich antwortete ihm daraufhin: „Weisst du, ich habe ausgelitten.“
Was hat dich dazu inspiriert, mit dem Bergsteigen zu beginnen?
Ausschlaggebend war mein unbändiger Bewegungsdrang. Ich war als Kind wie ein brodelnder Vulkan und ich musste irgendwie meine Energie kanalisieren, sonst wäre ich gefühlt explodiert. Ich habe mit dem Leichtathletiktraining angefangen, aber auch das hat mir schnell nicht mehr gereicht. Es war zu eintönig und langweilig. Der Alpinismus war dann für mich eine echte Befreiung von Körper, Geist und Seele. Ich konnte auf einmal alles machen – klettern, bergsteigen, Skitouren gehen und so weiter. Es waren zu Beginn nicht einmal die Berge, die mich so sehr fasziniert haben, sondern diese Freiheit. Die Spezialisierung auf das Bergsteigen hat sich dann nach und nach ergeben.

Liegt der Alpinismus in deiner Familie oder bist du auch da eine Pionierin?
Mein Vater hat früher auch Bergtouren gemacht. Aber als wir Kinder auf die Welt kamen, hat er das „Seil an den Nagel gehängt“. Wir waren aber gemeinsam auf vielen Wanderungen – also Wanderungen im Sinne von drei- bis viertägigen Touren. Das ist zwar noch kein Alpinismus, aber wir haben als Kinder schon gelernt, mit Extremsituationen umzugehen. Wir haben unfassbar schöne Momente in der Natur erlebt, mussten aber gleichzeitig auch unsere Rucksäcke tragen, hatten Blasen an den Füssen und Schmerzen. Wir waren schmutzig und hatten keine Möglichkeit zu duschen. Es gab da diese ganze emotionale Palette von Stolz über Scham bis hin zu Glück und Verzweiflung. Ich habe schon damals körperliche und mentale Grenzen erfahren, mit denen ich umgehen musste. Ich erkannte das erst sehr viel später, aber diese Wanderungen als Kind haben mich sehr viel gelehrt und ein wichtiges Fundament für die Bergsteigerei gelegt.
In der Schweiz zu leben und die hiesigen Berge zu erklimmen, ist das eine, das andere ist, den Mount Everest bezwingen zu wollen – wie kam es zu dieser Idee?
Das kam sukzessive. Ich fing an zu klettern, dann kamen das Mixed-Klettern [Kombination von Klettern am Eis und am Felsen, Anm. d. Red.] und das Sportklettern dazu. Mein Anspruch stieg immer ein wenig mehr. Ich war völlig fasziniert und getrieben und hatte so viele Ideen, wo und welche Routen ich als nächstes klettern möchte. So kam ich dann zum Alpinismus. Und irgendwann fing ich dann an, an den Himalaya zu denken – auch wenn das eigentlich zunächst gar nicht der Plan war. Ich hatte eine Ausbildung zur Hubschrauberpilotin gemacht und wollte mich selbstständig machen. Das ging aber leider fürchterlich schief.
Ungefähr zur gleichen Zeit bestieg ich gemeinsam mit drei anderen Bergsteigern die Eiger-Nordwand und das SRF übertrug diese Besteigung live im Fernsehen. Das sorgte für enorm viel Aufmerksamkeit [laut dem SRF schauten bis zu 80 Millionen Menschen aus halb Europa diesem Ereignis zu, Anm. d. Red.]. Dass bis dato noch nie eine Schweizerin auf dem Mount Everest gewesen war, wusste ich gar nicht. Das habe ich erst bei meinen Recherchen erfahren. Aber ab dem Moment war für mich eines klar: Dort gehe ich hin!
Die körperlichen Anstrengungen und physischen Herausforderungen sind enorm. Wie genau hast du dich dafür vorbereitet? Bist du auch ins Gym gegangen und gehst du heute ins Gym?
Oh ja, ich bin viel ins Gym gegangen. Als ich mit dem Bergsteigen angefangen habe, war ich noch durch die Leichtathletik spargeldünn. Gerade bei der Mittelstrecke zählt jedes Kilo. Ich würde sogar sagen, dass ich mit einer Grösse von 1,78 Metern und 47 Kilogramm ungesund dünn war. Ich hatte, wenn ich ehrlich bin, Probleme mit dem Essen damals. Für das Klettern ging es bei mir also erst einmal darum, Muskeln aufzubauen. Ich bin ins Gym gegangen und habe dort viel mit Bodybuildern trainiert. Ihre Philosophie, Muskeln aufbauen und zunehmen zu wollen, anstatt krampfhaft abzunehmen oder das Gewicht zu halten, hat mir eine völlig neue Perspektive gegeben und mich letztlich gesund gemacht, würde ich sagen. Zum Krafttraining kam natürlich auch immer wieder das Techniktraining am Berg selbst.
Die körperliche Verfassung und die technischen Skills konntest du trainieren, aber wie hast du dich mental auf so eine extreme Situation vorbereitet?
Auch das war ein Prozess, der in kleinen Schritten ablief. Mit allem, was ich erreicht habe und mit jeder Misere, aus der ich mich mit eigener Kraft wieder herausgearbeitet habe, ist die Selbstwirksamkeit und das Selbstvertrauen gestiegen. Das ist im Bergsteigen genauso wie im „normalen“ Leben. Was für Nicht-Bergsteiger vielleicht eine Horrorvorstellung ist, ist für mich als erfahrene Bergsteigerin eine mehr oder weniger normale Situation. Das ist Übungssache und verlangt viel Erfahrung. Beim Bergsteigen sind eine gute Reflexion und Selbsteinschätzung wichtig. Es geht nicht nur darum, Kraft zu haben, sondern eben auch darum zu wissen, wie viel Kraft ich selbst habe. Die mentale Stärke wächst mit der körperlichen. Beim Bergsteigen kann ich nicht mental stark sein und körperlich schwach. Das nützt mir nichts. Im Gegenteil, es bringt mich näher an den Absturz.
Wie war das Gefühl auf dem höchsten Punkt dieses Planeten zu stehen?
Offen gestanden war ich im ersten Moment eher verwundert –
„wow, ich bin oben!“. Aber dann war es ein überwältigendes Gefühl. Die letzte Etappe zum Gipfel bin ich nicht in einem Team gegangen. Diese Schwierigkeit allein zu meistern, war sehr intensiv. Ich war an der Nordseite des Everests und der zweite Aufschwung zum Gipfel ist überhängend und sehr anspruchsvoll. Der Rucksack war schwer, die Schuhe waren zu gross, damit mir die Zehen nicht abfrieren. Ich hatte zusätzlich Steigeisen und Sauerstoff dabei. Hinzu kam der dicke Daunenanzug, der mich in meiner Bewegungsfreiheit einschränkte. In dieser Situation allein und ohne Seil unterwegs zu sein, war schon eine absolute Grenzerfahrung. Es war unglaublich, als ich oben ankam und wusste, dass ich es geschafft hatte.

War das auch gleichzeitig der emotionalste Moment deiner Expedition?
Nein, das war er tatsächlich nicht. Als ich oben war, habe ich gefunkt, dass ich es geschafft habe und Russel, der Organisator, sagte nur zu mir: „Evelyne, this is only the half way!“ – ich musste ja auch wieder runter. Auf dem Abstieg hatte ich wahnsinnige Schmerzen im Nacken, ich konnte kaum mehr den Kopf halten. Ich war völlig erschöpft und am Ende. Ich traf eine Gruppe von Bergsteigern, die mir etwas Tee gaben. Diesen Tee werde ich nie vergessen. Aber der wirklich emotionalste Moment kam erst später. An diesem Tag hatte sich noch ein Drama zugespitzt, weil zwei Mitglieder aus unserer Expedition die Rückkehrzeit von 14.00 Uhr ignoriert und es nicht mehr zurückgeschafft hatten. Am nächsten Tag haben wir erfahren, dass sie noch leben, aber nicht mehr selbstständig runterkommen können. Die Rettungsaktion hat insgesamt vier Tage gedauert. Als klar war, dass wir es gemeinsam geschafft hatten, die beiden zu retten, war das der mit Abstand emotionalste und sogar spirituellste Moment, den ich bis heute erlebt habe.
Nach dem Mount Everest kamen noch der Nord- und der Südpol hinzu. Waren diese Ziele von Anfang an klar oder kam erst nach der Besteigung des Everests eine innere Unruhe in dir auf, neue Herausforderungen zu suchen?
Um ganz ehrlich zu sein, waren die Expeditionen zum Nord- und zum Südpol eher eine Notlösung für mich, weil ich nicht mehr Bergsteigen konnte. Ich wäre gern Höhenalpinistin geblieben und wollte als erste Frau der Welt alle Achttausender besteigen. Aber auf dem Mount Everest wurde mir leider klar, dass meine Lunge diese extremen Höhen nicht aushält. Ich habe das damals nicht öffentlich gemacht, weil ich keine Schwäche eingestehen wollte und habe dann sozusagen die Flucht nach vorne ergriffen. Daraus wurde die Idee geboren, zum Südpol zu gehen. Naja, und nachdem ich am Südpol war, lag die nächste Expedition zum Nordpol natürlich nahe.
Was treibt dich an, immer wieder in diese Extreme zu gehen?
Als ich vom Südpol zurückkam, war das mediale Interesse recht gross. Mein damaliger Freund wurde in einem Interview gefragt, warum ich so etwas tue, und er antwortete einfach nur: „Weil sie es kann!“ Das trifft es irgendwie ganz gut. Und es war zu dieser Zeit einfach mein Leben. Ich wollte mich zum Ausdruck bringen, Leistung zeigen, ein abenteuerliches Leben führen. Ich wollte einfach drauflosmachen, etwas umsetzen und bis ans Äusserste gehen. Ich hatte eine unbändige Neugier herauszufinden, wer ich bin und was ich fühle, wenn ich am absoluten Limit bin. Heute ist das, zum Glück, nicht mehr so. Gemerkt habe ich das, als ich nochmal an einem Achttausender war und spürte, dass es mich nicht mehr auf die gleiche Weise reizt. Deshalb habe ich dann auch nach zehn Tagen wieder meine Sachen gepackt und bin abgereist.
Bergsteigen und Extremtouren, vor allem auf einem Niveau, das derart an die körperlichen und psychischen Grenzen führt, waren jahrelang eine fast ausschliesslich von Männern geprägte Domäne. Hat es dich besonders gereizt, das alles auch als Frau zu schaffen?
Ja, am Everest schon. Es war ein gutes Gefühl und eine Befreiung es als erste Schweizerin auf den höchsten Berg der Welt zu schaffen. Am Süd- und am Nordpol war das anders. Da war der Druck höher. Wenn man als Mann auf dem Weg dorthin in Schwierigkeiten kommt und von den Russen von einer Eisscholle gerettet werden muss – wie es Thomas Ulrich passiert ist –, kann man diese Story noch erfolgreich verkaufen. Bei einer Frau hätte das wohl niemanden interessiert. Vielleicht weil man bei einer Frau das Scheitern bei so einem Unterfangen eher erwarten würde. Männer können Misserfolge besser verkaufen als Frauen. Das ist meiner Meinung nach ein grosser Unterschied.
Wie hast du als Frau das Bergsteigen erlebt, welche Herausforderungen hast du wahrgenommen und inwieweit unterscheiden sich die Herangehensweisen zwischen Männern und Frauen beim Bergsteigen aus deiner Sicht?
Der Berg fragt dich nicht nach deinem Geschlecht. Der Anspruchsgrad eines Berges ist für alle gleich. Als Frau habe ich gewisse Nachteile, insbesondere wenn es um das grobkantige alpinistische Bergsteigen geht. Ich habe die gleich schweren Rucksäcke getragen und musste die gleichen Schwierigkeiten überwinden – der Felsvorsprung oder die Spalte wurden ja nicht kleiner für mich. Hinzu kam, dass sich der hormonelle Haushalt im Zyklusverlauf veränderte und sich auch auf den Mut, die mentale Verfassung und die Leidensfähigkeit auswirkte. Das ist mir erst im Laufe der Zeit bewusst geworden. Ob Frauen grundsätzlich eine andere Herangehensweise haben, weiss ich nicht. Aber auf jeden Fall ist es bemerkenswert, dass es mittlerweile seit über 40 Jahren auch Bergführerinnen gibt und es mit ihnen noch nie einen tödlichen Unfall gegeben hat. Wobei ich natürlich dazu sagen muss, dass es viel mehr Bergführer als Bergführerinnen gibt.
Was haben dich die Erfahrungen auf deinen Touren für das alltägliche Leben gelehrt? Hat sich deine Perspektive auf bestimmte Themen geändert?
Jeder hat seinen eigenen Mount Everest. Nicht nur in Form eines Berges, sondern auch in Fragen des Lebens. Ich habe gelernt, dass ich mit Willenskraft sehr viel erreichen kann. Aber wenn es um das Emotionale geht, bringt mich Willenskraft nicht unbedingt weiter. Emotionale Verletzungen konnte ich nur mit der Zeit und durch Versöhnung heilen. Mit Willenskraft konnte ich zwar Durststrecken überwinden und am Leben bleiben, aber emotionale Krisen musste ich durchstehen. Am Ende hat mich der Berg vor allem eines gelehrt: Dankbarkeit.
Was machst du heute – beruflich wie privat?
Ich bin nach wie vor Bergführerin, ausserdem kümmere mich um mein Pferd. Darüber hinaus halte ich mit grosser Leidenschaft Vorträge und biete Coachings an. Dabei kann ich Menschen in schwierigen Situationen Mut machen – und genau das erfüllt mich sehr.

Über die Interviewpartnerin
Evelyne Binsack ist eine der ersten diplomierten Bergführerinnen weltweit, Extrembergsteigerin und Helikopterpilotin. Sie erreichte als erste Schweizerin den Gipfel des Mount Everest sowie den Nord- und den Südpol. Am 10. September 1999 durchkletterte sie die Eiger-Nordwand, was vom SRF live übertragen wurde.